Buchbesprechungen
Psychotherapeuten lüften ihr Geheimnis:
Peter Hain:
Das Geheimnis therapeutischer Wirkung.
Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie die Wirkung von Psychotherapien gemessen werden kann. Seit 1994 das Opus von Klaus Grawes zur Nutzenanalyse psychotherapeutischer Methoden erschienen ist, polarisiert die Frage der Wirkungsweise die Disziplin. Nun klinkt sich ein weiterer Autor in die lDebatte ein. Der Zürcher Psychotherapeut Peter Hain präsentiert mit seinem kürzJlich erschienenen Buch eine neue Gegenposition zu Grawes empirischem, meta-analytischem Ansatz. Bereits der Titel ist Programm: «Das Geheimnis therapeutischer Wirkung» signalisiert, dass eine gute Therapie mehr als eine brillante Heiltechnik bedeutet.
Um diese besondere Qualität auszuloten, interviewte Hain zehn erfahrene Psychotherapeuten, die zugleich prominente Exponenten unterschiedlicher Richtungen sind. Alle offenbarten bereitwillig ihren breiten Erfahrungsschatz, zusammengenommen ein Fundus aus Über 400 Praxisjahren.
Entstanden sind Einblicke in Erfolge und Misserfolge, Ahnungen und Reflexionen über die heilende Kraft der Psychotherapie. Zwar legen sich Status und Alter der Befragten - der jüngste ist 58 Jahre alt - wie Weichzeichner über die Gespräche. Doch das sensibilisiert für Zwischentöne und zwingt die Leser, selbst «therapeutische Antennen» wie Neugier, Aufmerksamkeit oder Empathie «auszufahren». Das lohnt sich, entdeckt man doch plötzlich Subversives. So kümmert es keine der Koryphäen, wenn sie um des Patienten willen einen methodologischen Tabubruch begeht und etwa für eine therapeutische Intensität plädiert, die jede psychoanalytische Distanz vermissen lässt. Und allmählich erschliesst sich, was es bedeutet, psychotherapeutische Methoden nicht als Handlungsanweisung, sondern als Grundlagenwissen einzusetzen, aus dem man in der Praxis souverän und gezielt schöpfen kann. Das Buch ist am stärksten, wo es die Befragten zu Wort kommen lässt, selbst wenn es die Interviews nur gekürzt wiedergibt. Mit dem Auswertungsteil, der Perspektiven für eine zukunftsorientierte Psychotherapie aufzeigt, beweist der Autor, dass die Wirkungsforschung von Expertengesprächen profitiert: Der Kern therapeutischer Beziehungen wird freigelegt.
Ruth Kuntz
Peter Hain: Das Geheimnis therapeutischer Wirkung.
(Gebundene Ausgabe vergriffen!)
eBook (PDF) 2012
Euro 14,00
ISBN 978-3-89670-885-4
Carl-Auer Verlag
Der Verlag für Systemisches
Bestellung/Download
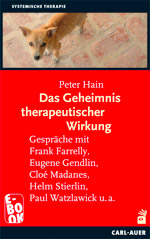
Psychotherapie auf dem Prüfstand -
Über Sitten und Gebräuche in helfenden Berufen
Bruno Peters
Asanger Verlag, Heidelberg, 2001
Bruno Peters ist Psychotherapeut und Schauspieler, und in dieser Kombination hat er im Bereich therapeutischer Theaterarbeit Zeichen gesetzt. Viele, vielleicht allzu viele Psychotherapeuten sind nach seiner Überzeugung "auf Inhalte und Texte fixiert, nicht aber auf Bilder, Geschichten, Figuren, Rollen oder gar Metaphern" (S. 74). Sie sind "Wortfetischisten", die "als Hüter der reinen Lehre ihrer therapeutischen Schule" (S. 44) immer wissen, was eine (z. B. "frühe") Störung ist und was der Klient an Einsichten gewinnen muss, um diese zu überwinden. Und da sie, die Psychotherapeuten, so viel wissen, dürfen sie mit Fug und Recht davon ausgehen, dass die menschliche Psyche ungeheuer komplizierte Probleme aufwirft, die eben nur ein wirklich eingeweihter Experte verstehen kann. Und das läuft auf die Erkenntnis hinaus, dass "alles schwer und nicht so einfach (ist), wie es (vielleicht) aussieht". Und vor allem "darf nicht laut gelacht werden" (S. 44)!
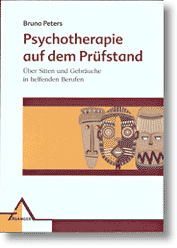
Unter dieser Voraussetzung kann der therapeutische Prozess zu einem wirklich "kreativen Vorgang" werden. Denn alles, was der Klient tut (oder nicht tut), kann so als die genuine Inszenierung eines impliziten Spielplans bzw. "Drehbuchs" aufgefasst werden. Dieses "gekonnte Spiel" mag vor den Augen der Welt als eine Ansammlung von Defiziten und Fehlleistungen erscheinen, doch wie der Clown ein (freiwilliger) Experte im Scheitern ist, der die Kunst des Stolperns virtuos beherrscht, so erweist sich auch der Klient des Psychotherapeuten als ein (unfreiwilliger) Experte - als jemand, der sein Symptomgeschehen zielgerichtet, also "sinnvoll" inszeniert, auch wenn er sich dieses Könnens gar nicht bewusst ist. Bruno Peters spricht in diesem Zusammenhang von einer Ressource: "Eine Ressource ist das, was eine Person gut kann" (S. 53). Und er empfiehlt folgerichtig: "Das, was man gut kann, muß man auf der Bühne vorzeigen und spielen" (S. 43), zum Beispiel die lebenslang eingeübte "Rolle als Schüchterner" (S. 11). Im (therapeutischen) Theater, das Peters als einen "wertfreien Raum" (S. 45) definiert, gibt es keine "Beurteilungen von gut oder schlecht, richtig oder falsch" (S. 44). Hier geht es allein um ein "Vorzeigen" und ein "Hinnehmen", um ein "Zulassen von Impulsen", ein "(An)Erkennen von Drehbüchern und Inszenierungen" und eine Identifizierung mit jenen "Figuren und Rollen", die im lebensgeschichtlichen Zusammenhang entstanden sind (S. 45).
Im Grunde handelt es sich hierbei um einen Prozess konsequenter Ermutigung, der den Klienten spielerisch an eigene Ressourcen heranführt, ohne dass die "rationale Geschichte im Kopf" (S. 45), die das rechte und falsche Handeln im Sinne gesellschaftlicher Normvorgaben erklärt, das kreative Spiel verderben kann. So bietet Bruno Peters eine verblüffend einfache Problemlösung an: "Lehre den Menschen das Entdecken seiner Kräfte, auch wenn sie verschüttet sind". Und dies gelingt immer dann, "wenn die (persönliche) Geschichte weitergeht und sich bewegt, jemand sich bewegt, kreativ und lebendig wird und mit Energie weiter improvisiert und in Kontakt bleibt" (S. 67).
Michael Titze
Clownsprechstunde - Lachen ist Leben
Joachim Meincke (Hg.)
Verlag Hans Huber Bern, 2000
Work in Progress - so könnte das Buch zusammenfassend beurteilt werden. Der Herausgeber präsentiert zusammen mit weiteren AutorInnen die bisherige Entwicklung, die das Clown-Projekt in einem Berliner Krankenhaus seit 1994 durchlaufen hat. Etwas vermeintlich Selbstverständliches - dass nämlich Heiterkeit auch innerhalb des Spitals seine Berechtigung hat - wird hier mit Text und Fotos eindrücklich dokumentiert. Zunächst unvorstellbar und gar - so wörtlich - "alptraumartig" gefürchtet, entwickeln sich die wöchentlichen Clownsprechstunden zu einem unersetzlichen Erlebnis - sowohl für die Kinder und Eltern wie auch für das Personal. Die Clowns beschreiben ihre Erfahrungen, die sie insbesondere mit chronisch kranken Kindern gemacht haben, und dabei sind sie Zeugen in allen Stadien verschiedenster Erkrankungen, einschliesslich bei sterbenden Kindern. Die Arbeit bewirkt beispielsweise bei einem Clown, dass er nach seinen Besuchen am Mittwochnachmittag nicht mehr voller Mitleid das Krankenhaus verlässt und nach der raschen Wirkung seines Besuchs fragt.
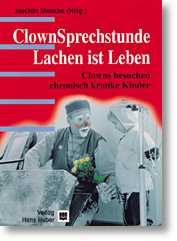
Hg. Dr. Joachim Meincke
Verlag Hans Huber
ISBN 3-456-83394-6
Nicht nur aus Sicht der Clowns, sondern auch die Schilderungen der VertreterInnen aus verschiedenen Krankenhausprofessionen belegen, dass die Clowns durch ihre einfühlende und wirkungsvolle Arbeit wesentlich zur Genesung der krebskranken Kinder beitragen und darüber hinaus die Krankenhausatmosphäre nachhaltig positiv prägen konnten. Damit dieses Experiment nicht zur "Eintagesfliege" mutieren konnte, wurden von Anfang an sowohl ein durchdachtes Finanzierungskonzept erarbeitet, sowie kontinuierlich Voraussetzungen für eine qualifizierte Clown-Arbeit reflektiert. Gespannt darf die Leserschaft nun auf eine Fortsetzung hoffen, in der nicht nur Kinder, sondern auch andere kranke Patientengruppen mit der Faszination der Krankenhaus-Clowns in Kontakt treten können.
CLiK e.V. - Clowns im Krankenhaus, ein Ende 1999 gegründeter Verein, der bestrebt war, die Clownsprechstunden in ganz Berlin zu etablieren. Gründungsmitglieder von CLiK e.V. waren u.a. Dr. Joachim Meincke, langjähriger Psychologe der II. Kinderklinik in Berlin-Buch und die dort seit mehr als 5 Jahren aktiven Clowns. Dr. Meincke war unser 1. Vorsitzender.
Von Dr. Meincke herausgegeben erschien das Buch:
ClownSprechstunde - Lachen ist Leben
Clowns besuchen chronisch kranke Kinder
Unsere Adresse ist
ROTE NASEN Deutschland e.V. - Clowns im Krankenhaus
Fröbelstrasse 15, Haus 13
D-10405 Berlin
Tel. 0049 30 498 55 900
Fax 0049 30 498 55 900
E-Mail: office@rotenasen.de
Homepage: www.rotenasen.de
Iren Bischofberger
Humour on the Couch
Alessandra Lemma
Whurr Publisher, London, 2000
Die britische Psychotherapeutin legt ein sorgfältig recherchiertes (englischsprachiges) Buch vor, das sich ergänzend in die bisherigen Werke im Bereich Humor und Psychotherapie einreiht. Durch die inhaltliche Verknüpfung von theoretischen Hintergründen und Beispielen aus ihrer psychotherapeutischen Berufspraxis werden die LeserInnen sinnvoll an die Bedeutung von Humor "auf der Couch", d.h. in der Psychotherapie, herangeführt.
Zunächst bekennt die Autorin, dass sie eigentlich Kabarettistin werden wollte. Mittlerweile erkennt sie jedoch entscheidende Parallelen ihrer eigenen Profession und derjenigen der KomikerInnen:
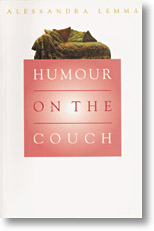
Im weiteren Verlauf des Buches bezieht vertieft und erweitert die Autorin durch Hinzuzug weitere Themen den Blickwinkel, unter anderem durch die Diskussion von Spiel, mentaler Gesundheit oder der Einfluss der Mutter auf die Entwicklung des kindlichen Humors. Und schliesslich analysiert sie selbstkritisch ihre eigene Rolle im beruflichen Umfeld der britischen Psychotherapie, in dem Humor mitunter als exotisch oder gar als unprofessionell betrachtet wird. Um Humor in dieser Profession zu verstehen, verweist sie auf das Verhältnis zwischen Therapeutin und Klientin, d.h. sie stipuliert eine reziproke Beziehung, in der Humor von beiden Seiten unweigerlich einfliesst und Bestandteil der Beziehung wird. Daher kann Humor als menschliches Charakteristikum kaum als exotisch, sondern viel eher als intrinsisch betrachtet werden.
Das Buch lässt - und dies ist beim Phänomen Humor durchaus verständlich und gerechtfertigt - viele Fragen offen. Nur eines weiss die Autorin mit Bestimmheit: Das Buch ist nicht lustig. Sie entschuldigt sich dafür in keiner Weise, sondern regt viel mehr dazu an, durch die geschärfte und differenzierte Sichtweise die kommunikativen, beziehungsinhärenten und innovativen Werte, die durch Humor akzentuiert oder gar entdeckt werden können, zu ergründen.
Iren Bischofberger
Robinson, V.M.
Praxishandbuch Therapeutischer Humor.
Ullstein Medical, Wiesbaden, 1999
Die amerikanische Autorin Vera Robinson gilt als Pionierin zum Thema Humor in der Pflege, denn bereits in den 60er Jahren begann sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit in Pädagogik mit der bahnbrechenden wissenschaftlichen Erforschung von Humor. Das vorliegende Werk führt ihren reichen Wissens- und Erfahrungsschatz zusammen und präsentiert den LeserInnen eine vielfältige Palette von theoretischen und anwendungsorientierten Kapiteln. Was der Volksmund mit "Lachen ist die beste Medizin" umschreibt, wird hier für Pflegende zum wertvollen Fundus für die Berufspraxis. Vorerst gilt es, Humor zu benennen und - unter Berücksichtigung von Widersinnigkeiten, Dilemmata und Kontroversen - den Versuch zu wagen, eine Definition zu formulieren.
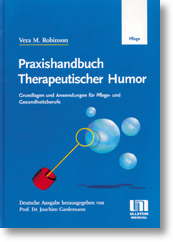
Darüber hinaus beschreibt die Autorin die Wirkung des Humors in spezifischen Bereichen des Gesundheitswesens, z.B. in der Psychiatrie, bei Kindern, bei Betagten oder in der Ausbildung. Sie belässt es nicht nur bei der Beschreibung der verschiedenenen Kontexte, sondern schlägt den LeserInnen vor, sich konkret mit den Techniken der Komik vertraut zu machen, und sie vermittelt dazu wertvolle Empfehlungen. Es geht dabei nicht darum, als Pflege-Clowns aufzutreten, sondern den eigenen Sinn für Humor zu entdecken und daraus abgeleitete Humorinterventionen einzuüben.
Fazit: Robinson präsentiert ein Werk, das nicht nur in jede Bibliothek Eingang finden sollte, sondern in die Herzen aller Mitarbeitenden im Gesundheitswesen.
Iren Bischofberger
Länder des Lachens.
Reisen zu heiteren Menschen
Heiner Uber, Papu Pramod Mondhe
Frederking & Thaler, München, 2000
Der Journalist Heiner Uber wählte für sein Buch über das Lachen die Metapher des Reisens. Und wie die meisten Reisenden ihre Eindrücke mit Fotos belegen, so nahm Uber den Fotographen Papu Pramod Mondhe mit, der wunderbare Fotos von lachenden Menschen dem Reisebericht hinzufügte.
Die Reise beginnt bei den "Lacherinnerungen" des Autors in der Schule, wo er nicht laut lachen durfte. Er macht sich auf zu den Eskimos, bei denen er den Gesängen zur Erlangung der Fröhlichkeit beiwohnt. Uber gelangt, wie sollte es anders sein, auch nach Bombay, begegnet dort Madan Kataria, und erzählt in seinem Buch von Lachclubs und dem indischen Gefängnis, in dem gelacht wird. Er begegnet Parveti Nair, die ihre Krankheit lachend überwunden hat. Seine Reise geht weiter nach Kopenhagen. Dort erzählt er von Jan Thygesen Poulsen, der einen nationalen Lachtag organisierte. Von Dänemrk aus geht es zu den Navajo-Indianern, die über die Gebrechen der Alten lachen: bei Tänzen, in denen sie mit Lachen die Sonne verehren. Uber erzählt auch die Geschichte vom listigen Kojoten. Später berichtet er von William Fry und Paul McGhee, womit er einen kleinen Ausflug in die Wissenschaft unternimmt und auch zu Michael Titze kommt. Nach diesem ernsteren Ausflug in die Wissenschaft berichtet Uber sodann vom Fest der Göttin Niutsuhime in Japan. Durch das Lachen wurde diese besänftigt, und das wird heute noch gefeiert! Dann erzählt Uber von den Klinikclowns in München, und von dort geht es dann zur Clownschule nach Hannover. Und schliesslich ist der Leser in Italien bei Titino und der commedia dell' arte, um die Reise wiederum in Bombay zu beenden.
Das Buch ist gewiss keine wissenschaftliche Abhandlung über das Lachen; manches ist auch nicht ganz exakt recherchiert. Dies tut dem Buch keinen Abbruch, da Uber es schafft, journalistisch dem Leser vorstellbar zu machen, wie oder was man erlebt, wenn man sich der Lachkultur aussetzt. Es wird so konkret beschrieben, wie in den Lachclubs gelacht, Übungen werden erklärt, und es dürfte das erste Buch zum Lachen sein, das in dieser leichten und anschaulichen Weise die "Mission" der Lachapostel verständlich macht und weitertragen könnte.
Thomas Holtbernd
Über das Lachen
Thomas Chorherr
NP Buchverlag
St. Pölten - Wien - Linz, 2000
Wer konkrete Informationen zum Lachen sucht, der findet sie in diesem Buch von Thomas Chorherr. Es werden zu unterschiedlichen Themen wie Philosophie und Lachen, die Antike und das Lachen, Glück und Lachen, Management und Lachen, jüdischer Humor usw. die wesentlichen Inhalte kurz und knapp beschrieben. Schade ist, dass keine Literautrhinweise gegeben werden, weil man bei manchen Themen doch gerne mehr wissen möchte. Die einzelnen Artiekl sind leicht geschrieben, decken aber alles auf, was man zum Thema zunächst wissen muss, und informieren. Gelungen an diesem Buch ist die grosse Vielfalt der unterschiedlichen Aspekte des Lachens, die dargestellt werden. Es ist nicht rein kulturhistorisch oder psychologisch, es ist allgemein gehalten. Vielen anderen Büchern über Humor und Lachen fehlt diese Breite. Zum Schluss hat man allerdings ein wenig den Verdacht, das bestimmte Passagen nur deshalb aufgenommen wurden, damit das Buch dicker wurd. Trotzdem: Der Informationsgehalt ist hoch, so dass das Buch eigentlich eine Pflichtlektüre für alle Lacher sein sollte, da es auch sonst nichts Vergleichbares gibt.
Thomas Holtbernd